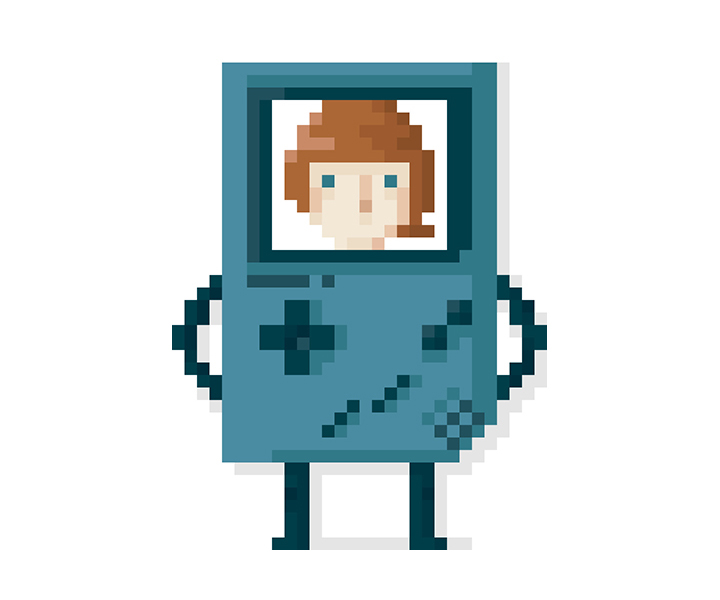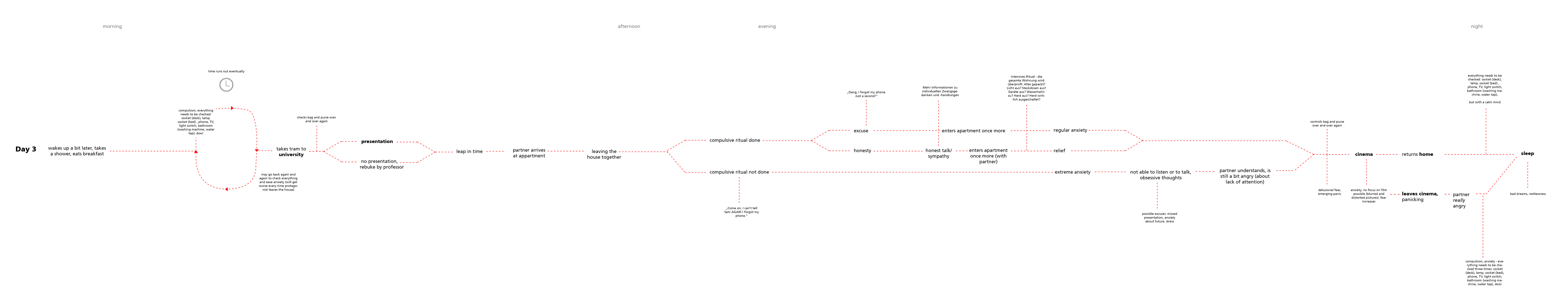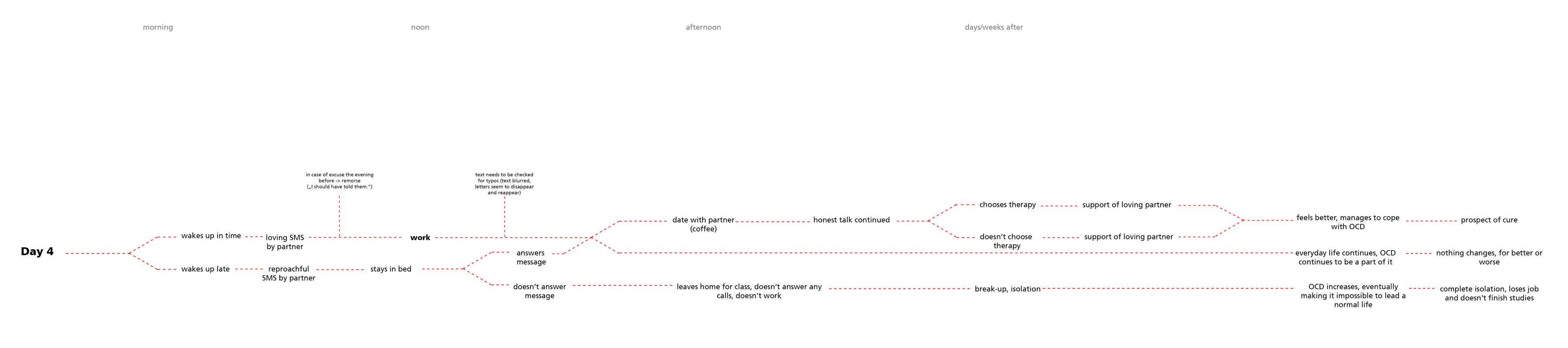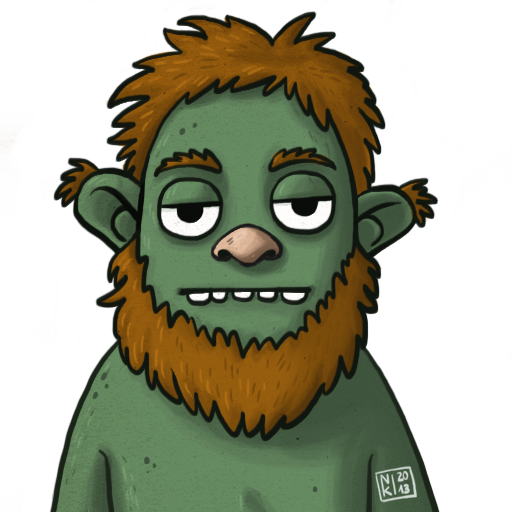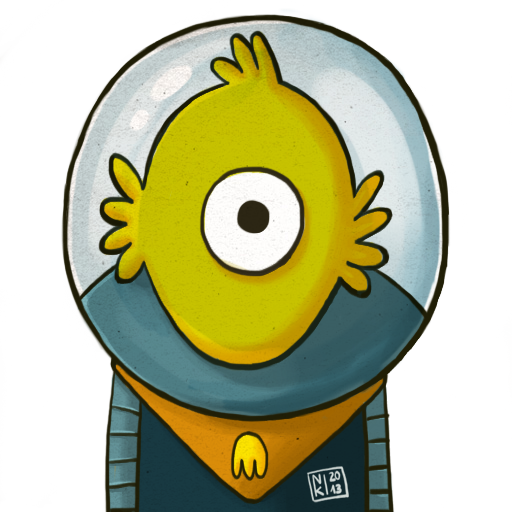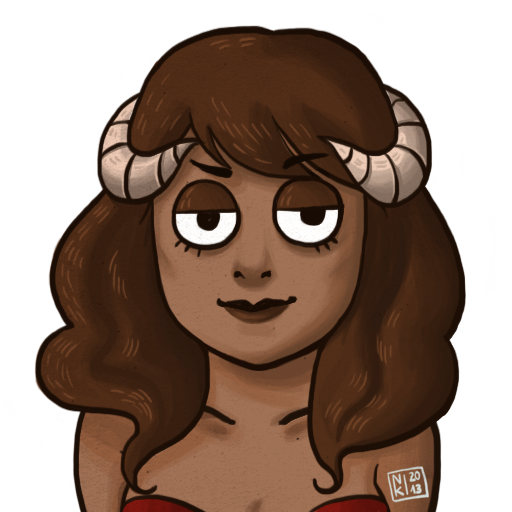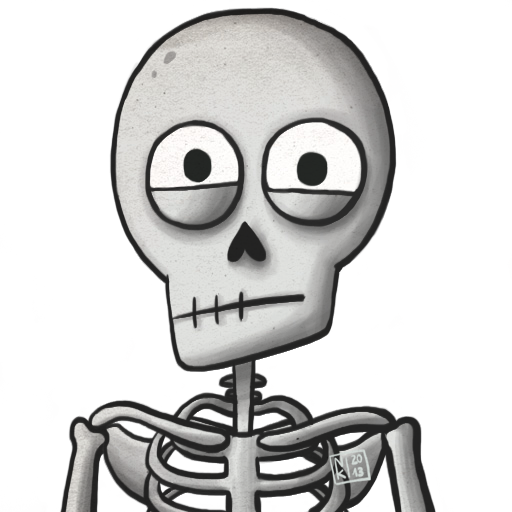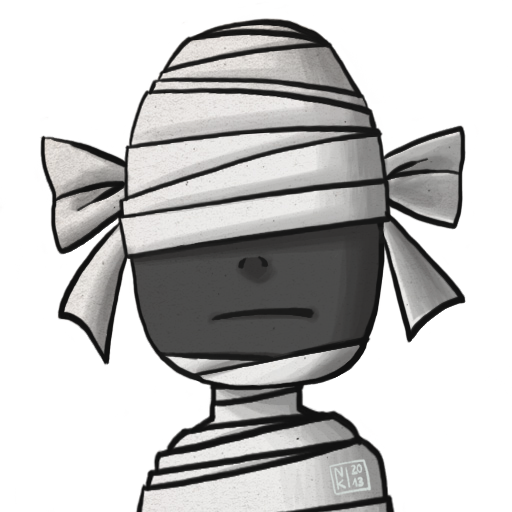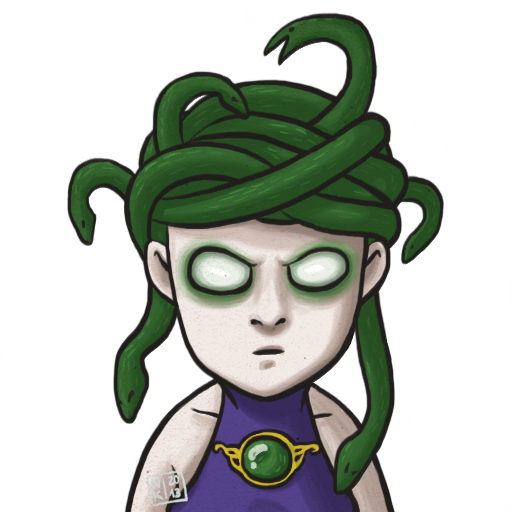© Blizzard Entertainment
© Blizzard Entertainment
Eine kreuzförmige Narbe über dem rechten Auge. Wohldefinierte, tätowierte Oberarme. Und: Pinkes Haar. Aleksandra Zaryanova ist eine von zwei neuen Figuren, die Spieleentwickler Blizzard kürzlich der Heldenriege seines bald erscheinenden Titels „Overwatch“ hinzufügte. Als erste Bilder der muskulösen Soldatin an die Öffentlichkeit gelangten, war die Begeisterung groß, denn Frauen wie diese sind in Spielen Ausnahmeerscheinungen.
Ebenso außergewöhnlich wie “Zarya” selbst ist ihre Entstehungsgeschichte. Als Blizzard im November des vergangenen Jahres auf der hauseigenen Messe in Kalifornien die erste neue Marke seit 17 Jahren präsentierte, versprach die Firma nicht nur in diesem Sinne industrierelevante Neuerungen. Chris Metzen, der Vice President of Creative Development, berichtete während einer Pressekonferenz von einem Gespräch mit seiner Tochter, das ihn nachdenklich stimmte. Denn nachdem die beiden gemeinsam einen „World of Warcraft“-Trailer gesehen hatten, fragte ihn sein Kind, warum bloß alle weiblichen Charaktere Badeanzüge tragen würden. Und er wusste darauf keine Antwort. Klar war für ihn daraufhin nur, dass sich etwas ändern musste – und dass der neue Titel „Overwatch“ eine geeignete Plattform dafür sein würde, Rollenvorbilder für Frauen vorzustellen, die vom traditionell sexualisierten Ideal abweichen. „We want girls to feel kick-butt. Equally represented“, so Metzen.
Und tatsächlich: Fünf der insgesamt fünfzehn anschließend vorgestellten, spielbaren Figuren waren weiblich – immerhin ein Drittel und damit deutlich mehr, als es sonst in Spielen üblich ist. Von einer ausgeglichenen Besetzung konnte damit zwar keine Rede sein, doch die dahinterstehende Absicht war als Fortschritt zu werten. Nur legte ein schweifender Blick über die farbenfrohe Gruppe legte ein ganz anderes Problem offen: Die Gleichsetzung von Weiblichkeit und Schönheit. Denn während die männlichen oder – auf den ersten Blick – geschlechtlich uneindeutigen Figuren ein breites Spektrum von Körpergrößen, -formen und individuellen Persönlichkeiten abdecken, sind jene fünf Frauen durchweg jung und grazil, ihre Körper variieren nur geringfügig voneinander. Als Ausnahme mag Pharah wahrgenommen werden, die in ihrer massigen, blauen Rüstung einen Vergleich mit Samus Aran nicht zu scheuen bräuchte. Stellt man sie allerdings ihren schwerbepanzerten, männlichen Pendants gegenüber, wirkt die zunächst beeindruckende Gestalt geradezu winzig. Sie mag als Besonderheit erscheinen – allerdings nur in dem eng umrissenen, ästhetischen Rahmen, der Frauen zugestanden wird.
Nun ist dieses kein videospielexklusives Phänomen, vielmehr spiegelt das Medium wider, was in unserer Gesellschaft als schön wahrgenommen und reproduziert wird. Die Idealisierung einer jugendlichen Makellosigkeit, die kein reales Vorbild hat, sondern durch und durch künstlich ist, führt zur Normierung einer unerreichbaren Form von Attraktivität. Und so verwundert es nicht, wenn selbst Spieleentwickler_innen mit einem kritischen Bewusstsein für stereotype Darstellungen von Weiblichkeit ein solcher faux-pas unterläuft. Auch sie unterliegen medialen Einflüssen, die ihr Welt- und Menschenbild prägen.
Seltsam ist es dennoch, dass solche Fehler immer wieder passieren, denn im Grunde würde ein kurzer Blick aus der Haustüre genügen, um die tatsächliche visuelle Bandbreite zu erkennen, die der menschliche Körper abdeckt. Sicher: Klassische Heldenfiguren werden bewusst idealisiert, sind innerlich wie äußerlich makellos. Analysiert man jedoch die Darstellung von Männlichkeit in diesem wie auch anderen Medien, zeigt sich eine große Auswahl alternativer Entwürfe, die dem Marketingideal gegenübergestellt wird: Der liebenswerte, schlacksige Nerd rettet die Welt, der untersetzte Klempner seine Prinzessin, und der von Alkohol- und Drogenmissbrauch gezeichnete Antiheld bewältigt, wenngleich latent mürrisch und immer mit einem zynischen Spruch auf den Lippen, pflichtbewusst seine Missionen.
Mehr noch können maskulin konnotierte Figuren monströs erscheinen – so auch Winston, das durch seinen Namen und seine Stimme eindeutig als männlich zu identifizierende Quotentier in „Overwatch“. Feminine Gegenbeispiele dieser Art gibt es so gut wie keine. Ausnahmen sind überwiegend an den Wegesrändern gigantischer Rollenspielwelten und in Beat’em-Ups zu finden. So unter anderem in „Bloody Roar“, dessen Frauenfiguren sich jedoch überwiegend als rotäugige Häschen, flauschige Catgirls und Fetischkleidung tragende Füchse entpuppen. Lediglich Mitsuko, deren tierisches Alter-Ego in Form eines Wildschweins daherkommt, bricht bereits in ihrer menschlichen Form mit allen tradierten Formen femininer Attraktivität. Mehr noch gilt dies für Vertigo aus dem 90er-Jahre-Prügler „Primal Rage“, eine echsenförmige, giftspeiende Göttin, die Jim Sterling vor anderthalb Jahren konsterniert zum einzigen innovativen, weiblichen Charakter der Videospielgeschichte ernannte.
Und im Prinzip hat sich seither nicht viel geändert. Ungeachtet des anhaltenden Diskurses über die Darstellung von Weiblichkeit im Spiel, konzipiert eine Mehrheit der Character Designer – vielfach auf Anweisung ihrer Vorgesetzten – Männer im Hinblick auf ihre Rolle im Spiel und Frauen als Dekoobjekte. In diesem Sinne aufgefallen ist auch Blizzard nicht erst mit „Overwatch“. Als das Unternehmen ankündigte, die nach fast fünfzehn Jahren etwas angestaubte Grafik seines MMORPGs „World of Warcraft“ überarbeiten zu wollen, zeigten die ersten Character Sheets Männer mit deutlich erkennbaren Charakterzügen, Makeln und bisweilen grotesker Anatomie. Und schöne Frauen. Selbst die Orc- und Trolldamen wirkten inmitten ihrer buckeligen Verwandschaft erstaunlich filigran und präsentierten apathisch dreinblickend die Frisurentrends des Jahres.
Einiges deutet darauf hin, dass solche Darstellungen von der zahlenden Kundschaft gewünscht werden – und das auch von deren weiblichem Anteil. Studien zeigten in der Vergangenheit wiederholt, dass ein eng gefasstes Schönheitsideal zwar zu einer negativen Selbstwahrnehmung führen kann, viele Frauen ihre idealisierten und auch sexualisierten Abbilder aber bevorzugen, insbesondere in Spielen. Zurückführen lässt sich das auf sozial etablierte Vorstellungen von Weiblichkeit, die verinnerlicht und als erstrebenswert wahrgenommen werden, sowie auf die in den Medien weit verbreitete Verknüpfung von Stärke und Sexiness. Wer dem Ideal im Arbeits- und Beziehungsalltag nicht entsprechen kann, adaptiert es eben im digitalen Raum.
“Such a positive reaction is understandable given that in our pop culture it is often the woman in leather, who is sexualized to some degree, that is the strong, active, independent and competent fighter alongside her male counterparts (Brown, 2004). It may be that the women who picked the hypersexualized character were responding to this common portrayal, interpreting the hypersexualized as the more powerful, and thus the most likely to be successful in the game.” – CarrieLynn D. Reinhard (“Hypersexualism in video games as determinant or deterrent of game play: Do men want them and do women want to be them?”)
Werden schlagkräftige, durchsetzungsfähige Frauen mehrheitlich als üppig proportioniert und weniger üppig bekleidet präsentiert, liegt es nahe, unwillkürlich einen an sich nicht existenten, kausalen Zusammenhang zwischen diesen Eigenschaften herzustellen. Und in Folge dieses nahezu unerreichbare Gesamtkonzept als wünschenswert wahrzunehmen. Eben drum trifft man in MMORPGs allerorten auf zierliche Elfen, bildschöne Kriegerinnen und allenfalls dezent hakennasige Orcs, selbst wenn diese Spiele durch komplexe Charakter-Editoren zumindest punktuell die Möglichkeit bieten, von diesen Standards abzuweichen.
Zuverlässig folgt daher stets der Einwand, dass die Nachfrage das Angebot bestimme, die Konsument_innen selbst für diese Inhalte verantwortlich seien und es ergo gar kein Problem gäbe, dass es zu kritisieren oder gar zu beseitigen gelte. Diese Argumentation aber vernachlässigt den Aspekt der medialen bzw. sozialen Prägung und damit die Tatsache, dass unser Schönheitsempfinden durch äußere Einflüsse maßgeblich mitbestimmt wird. Sie ignoriert, dass mediale Inhalte das wackelige Fundament unserer Selbstwahrnehmung sind und dass wir zum Eskapismus genötigt werden, weil wir uns in unseren unperfekten Körpern nicht mehr wohlfühlen können.
Die Gleichsetzung von Femininität und Schönheit ist eine ebenso weit verbreitete wie willkürliche. Frauen sind nicht per se anmutiger, attraktiver und aufreizender als Männer. Vielmehr hebt diese spezifische Form der Idealisierung Frauen aufgrund ihres zufällig generierten Gen- oder sehr bewusst konzipierten Polygonpools auf ein Podest, von dem sie nicht herunterklettern können, weil es ästhetische Gefälligkeit als höchstes Gut und selbstbestimmtes Handeln als sekundär kennzeichnet. Auch der Wert gestandener Heldinnen bemisst sich nach wie vor an ihrer Körbchengröße, ihren feinen Gesichtszügen und damit an ihrem ästhetischen Marktwert – obwohl der für ihre spielinternen Rollen gemeinhin nicht relevant ist.
Umso wichtiger sind daher Figuren wie „Zarya“, weil sie ein Bewusstsein für diese Probleme und ein offenes Ohr einiger Firmen für die Kritik ihrer Kund_innen erkennen lassen – und sei es nur aus ökonomischen Gründen. Die stämmige Bodybuilderin stellte eine direkte Reaktion auf die Unzufriedenheit dar, die angesichts des einseitigen Weiblichkeitsideals in „Overwatch“ an Blizzard herangetragen wurde. Zwar repräsentiert die burschikose Russin ebenfalls ein Stereotyp, das berechtigterweise kritisiert wurde. Wenn nun aber Tür und Tor geöffnet wurden für muskulöse, stämmige, runde und – das ist besonders wichtig – alte Frauen, besteht Hoffnung auf mehr Vielfalt. Und ein Menschenbild in Videospielen, das dem auf unseren Straßen zumindest ansatzweise entspricht. Glatte, weiche Haut, dünne Gliedmaßen und wallendes Haar sind Indikatoren für Attraktivität, aber bei weitem nicht die einzigen. Es gibt so viele Formen der Schönheit und es wird Zeit, dass wir unsere Augen wieder dafür öffnen.
Eine gekürzte und geänderte Fassung dieses Textes wurde bei Zeit-Online veröffentlicht.